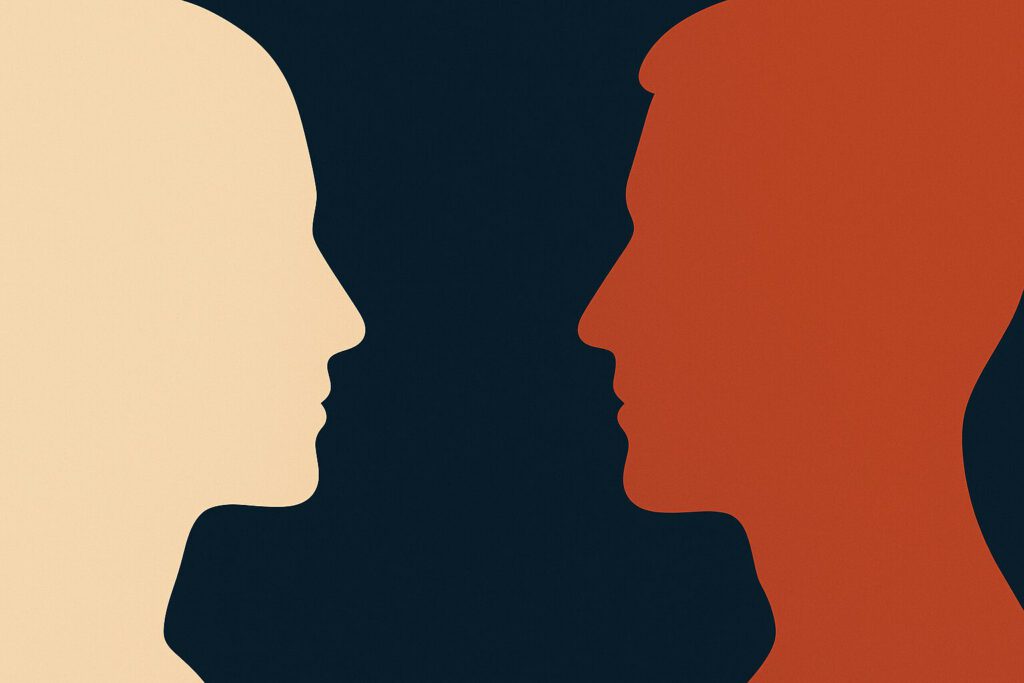
Wir reden viel und begegnen uns wenig. In Talkshows werden Standpunkte abgefeuert wie Konfetti. In unseren Feeds gewinnen Zuspitzung und Empörung; der Algorithmus liebt das Kurzformat, einminütige Clips reichen, um Stimmungen zu drehen. Wir diskutieren nicht, wir deklarieren. Genau in dieses Klima gehört ein Wort, das mehr ist als ein Wohlfühlbegriff: Fremdverstehen.
Fremdverstehen ist nicht die freundliche Variante des Wegschauens. Toleranz sagt: Ich ertrage dich, solange du mich nicht störst. Das beruhigt, aber verbindet nicht. Fremdverstehen heißt: die Perspektive des Anderen so ernst zu nehmen, dass ich sie für einen Moment als mögliche Realität mitdenke – ohne meine eigene zu verlieren. Der Theologe und Professor (i. R.) Theo Sundermeier hat diese Bewegung als Hermeneutik beschrieben: den Anderen als Subjekt anerkennen, seine innere Logik verstehen, bevor ich widerspreche. Erst verstehen, dann streiten. In einer Aufmerksamkeitsökonomie, die Ragebait belohnt, ist das fast schon subversiv.
Warum das gerade jetzt zählt, spüren viele von uns täglich. Wir sind mit Pandemie, Klimawandel, Rezession und dem Krieg gegen die Ukraine erwachsen geworden – bzw. in unseren Anfang 20ern durch genau diese Krisen gegangen. Künstliche Intelligenz beschleunigt Prozesse und stellt zugleich Einstiege infrage. Debatten über Migration kippen schnell in Lagerlogik. In dieser Gemengelage ist Toleranz zu dünn. Sie organisiert Abstand, wo Nähe und Kooperation nötig wären. Fremdverstehen ist keine weiche Geste, sondern eine harte Zukunftskompetenz: zuhören, Kontexte bilden, Ambivalenzen aushalten, Urteilskraft schärfen.
Was mich überzeugt hat, kommt nicht aus Büchern, sondern aus Begegnungen. Ich habe im Alter von 16 Jahren insgesamt eineinhalb Jahre in Neuseeland gelebt, in einer Gastfamilie. Dort wurde spürbar, wie stark Kultur Identität prägt. Die Māori-Kultur ist keine Folklore am Rand, sondern eng verwoben mit Sprache, Ritualen, Geschichtsbildern und einem gelebten Respekt vor Land und Natur. Diese Verflochtenheit verändert, wie ein Land sich selbst versteht: Zugehörigkeit, Verantwortung, Gemeinschaft – all das hat ein anderes Gewicht. Mir hat das einen neuen Blick auf Kultur gegeben: Sie ist nicht Dekor, sondern Rahmen. Sie ordnet, was als normal gilt, woraus Menschen Sinn ziehen, welche Geschichten verbinden.
Italien – in meinem Fall: Sardinien – hat mir, so nah es geografisch scheint, eine ganz andere Sozialarchitektur gezeigt. Längere gemeinsame Mahlzeiten, Zeitfenster, die nicht in 30-Minuten-Slots passen, Geselligkeit als gelebter Alltag. Familie ist dort nicht nur privat, sondern soziale Infrastruktur. Die Uhren ticken anders; das verändert, wie Gespräche anfangen, wie Konflikte gelöst werden, wie Nähe entsteht. Es gab Hürden, auch sprachlich. Und gerade deshalb war es bereichernd: andere Abläufe, andere Traditionen, eine andere Logik von Zusammenhalt – mitten in Europa.
In Schweden, während meines Masters in Lund, habe ich mit fünfzehn Menschen unter einem Dach gelebt. Unterschiedliche Sprachen, Rituale, Empfindlichkeiten. Reibung war normal. Fremdverstehen hieß hier: Konflikte nicht als Störung abhaken, sondern als Daten lesen. Was stößt an? Was ist uns heilig? Wo liegen unsere blinden Flecken? Vielfalt ist schön und anstrengend zugleich; entscheidend ist, ob wir Reibung als Defekt bekämpfen oder als Lernsignal nutzen.
Diese Erfahrungen haben einen gemeinsamen Kern: Man muss nichts übernehmen, um durch das Fremde klüger zu werden. Fremdverstehen ist keine Selbstaufgabe, sondern Selbsterweiterung. Wer die innere Logik des Anderen wirklich verstanden hat, widerspricht präziser, fairer, wirksamer. Streit verliert Pose und gewinnt Substanz.
Wichtig dabei: Generation Z ist kein Block, keine homogene Gruppe. Wir teilen eine Zeit, aber nicht dieselben Startlinien. Internationale Kontakte sind heute selbstverständlicher – Programme, Stipendien, digitale Communities öffnen Türen –, doch Zugang, Ressourcen, Pässe, Sprache, Region, Care-Verantwortung und Diskriminierungserfahrungen verteilen Chancen ungleich. Fremdverstehen heißt, diese Asymmetrien mitzudenken. Gleichwürdigkeit statt Gleichmacherei: anerkennen, dass Wege verschieden lang sind, ohne Erwartungen zu senken.
Was folgt daraus für unsere Debattenkultur? Nicht noch mehr Lautstärke, sondern anderes Design. Tempo rausnehmen. Fragen vor Thesen. Biografie vor Beweis: Welche Erfahrung prägt deinen Blick? Begriffe klären: Wenn du Sicherheit sagst, was heißt das in deinem Alltag? Die beste Version der Gegenposition formulieren – erst dann kritisieren. Eigene Zweifel markieren. Klare Grenzen benennen, wo Menschenwürde verletzt oder Gewalt legitimiert wird. Das ist kein Relativismus. Es ist Arbeit an Urteilskraft. Sie verlangsamt den Streit, damit er trifft, wo es zählt.
Und für Arbeit und Ausbildung? KI automatisiert Routinen. Was bleibt, sind Aufgaben, die Maschinen nicht können: Kontext verstehen, Beziehungen bauen, Ambiguitäten sortieren. Genau dort lebt Fremdverstehen. Teams, die zuerst Kontexte sammeln und dann entscheiden, produzieren weniger Theater und robustere Lösungen. Hochschulen, die Fragenqualität bewerten und nicht nur Thesenstärke, bilden Menschen aus, die mehr können als gewinnen. Medien, die Lebenslagen erzählen, bevor sie Positionen bewerten, erzeugen Resonanz statt nur Reichweite.
Fremdverstehen ist eine Zumutung. Es kostet Zeit, Korrekturbereitschaft, Nerven. Es schenkt im Gegenzug etwas, das die Rage-Logik uns abgewöhnt hat: die Erfahrung, verstanden zu werden. Wer das erlebt, redet anders. Wer es übt, führt anders. Wer es einfordert, baut Räume, in denen Unterschiedlichkeit nicht Gefahr ist, sondern Ressource.
Vielleicht fangen wir genau hier an: nicht bei den Schlagworten, sondern bei der inneren Haltung. Nicht nach dem nächsten Aufreger greifen, sondern nach einem Gespräch. Die Aufgabenliste ist lang: Klima, KI, Krieg, Migration. Handlungsfähig werden wir nicht mit neuen Parolen, sondern mit einer alten Kunst, neu gelernt: Fremdverstehen. Kurz die Welt des Anderen tragen. Die eigene Welt klüger zurückbekommen. Und dann – unbedingt – streiten. Nur besser. Nur hilfreicher. Nur so, dass Zukunft draus werden kann.
